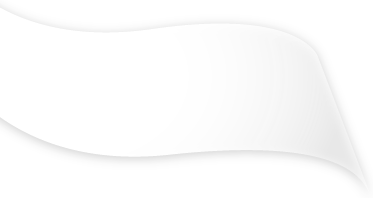Museumsportrait
Ein ganzes Museum, nur für Trachten? Aus Württemberg? Ja gibt es denn da genug zu zeigen? Wenn die Rede auf das Württembergische Trachtenmuseum kommt, ist das Erstaunen gross. Noch grösser ist die Überraschung dann bei einem Besuch des Museums. Bis heute hat der Schwäbische Albverein eine einzigartige Sammlung bäuerlicher Kleidung zusammengetragen, die fast lückenlos alle Hauptformen des ehemaligen Königreichs Württemberg umfasst. Zu seinem hundertjährigen Jubiläum im Jahr 1988 eröffnete der Schwäbische Albverein ein Museum für diese Sammlung.
Sie befindet sich seit 1988, im Wohnteil der 1799 erbauten Baumannschen Mühle. Im Anbau des Hauses befindet sich das Mühlenmuseum, mit einer voll funktionsfähige Getreidemühle. Beide Museen werden, mit Unterstützung der Stadt Pfullingen, durch Mitglieder des Schwäbischen Albverein, OG Pfullingen ehrenamtlich betreut.
Vielfalt historischer Alltagsbekleidung
Das Trachtenmuseum zeigt auf drei Stockwerken die Alltagskleidung der ländlichen Bevölkerung zwischen ca. 1750 und 1900. Das Gebiet Altwürttemberg, aus dem ein Grossteil der ca. 180 Exponate der Dauerausstellung stammen, umfasste Neckartal, Albvorland, Schwäbische Alb, das Gebiet um Ulm, Härtsfeld mit Ellwangen, Hohenlohe, evangelisches und katholisches Gäu, Filder und die Einzugsgebiete Reutlingen und Tübingen sowie die Bollenhuttracht, die Sankt Georgener Tracht und die Tracht von Lehengericht. Es geht in der Dauerausstellung nicht darum hauptsächlich die schönsten und kostbarsten Stücke zu zeigen, sondern um die Tracht als Teil der Alltagskultur. Sie zeigt jeweils das Bild einer bestimmten Bevölkerungsschicht in einer bestimmten Zeit und Region. Jedes der ausgestellten Stücke war einmal Teil des Kleiderbestandes einer Privatperson. Nicht immer ist bekannt, wer es getragen hat, weil vieles auch mehrfach vererbt wurde. Zu sehen sind alle Varianten, von der Jugend bis zum Alter, von Werktag bis Sonntag und vom Fest bis zur Trauer. Nicht jede Form ist komplett vorhanden, aber dennoch, oder gerade deshalb, wird deutlich wie vielfältig die Kleidung war und wie sie sich durch die jeweiligen Modeeinflüssen gewandelt hat. Bänder, Hauben, Tücher und sonstiges Zubehör ergänzen das Bild.
Trachten im Wandel der Zeit
Trachten sind Kulturgut, ein Stück Alltagskultur der bäuerlichen Bevölkerung vom 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Nach dem dreißigjährigen Krieg hatten die Bauern die Möglichkeit, sich nach und nach ein eigenes Kleidungsverhalten zu schaffen. Diese Kleidung ist, wie die Mode von Adel und Bürgertum auch, ein Spiegel ihrer Zeit. Die eine Originaltracht gibt es nicht, auch wenn heute bei Heimatfesten ein anderer Eindruck entsteht. Während einer sehr langen Zeit bestand die Bekleidung der einfachen Bevölkerung aus schlichten Hosen, Röcken und Hemden. Nur der Adel konnte sich etwas Besseres leisten, sodass sich „Mode“ zuerst nur in diesen Kreisen entwickelte. Später war es dann auch dem neu entstehenden Bürgertum möglich, sich bei ihrer Kleiderwahl nach der aktuellen Mode, zu richten. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es noch strenge Kleiderordnungen, die nicht nur festlegten, wer welche Stoffe nutzen durfte, sondern auch, was die jeweilige Bevölkerungsgruppe dafür maximal ausgeben durfte. Das war eine wichtige Maßnahme, um die einzelnen Stände deutlich voneinander abzugrenzen. Erst nach der Französischen Revolution wurden diese Regeln abgeschafft. Dreiviertel der Bevölkerung gehörte dem untersten Stand an. Dazu gehörten auch die Bauern, die sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine „standesgemässe“ Mode schufen.
Nachhaltigkeit als Prinzip ermöglichte sukzessive Neuerungen
Damals lebte man nachhaltig. Man achtete auf Qualität und wo es nötig war, wurde geflickt und ausgebessert. Alles wurde so lange weiter vererbt, bis es nicht mehr tragbar war. „Mit dem Alten das Neue erhalten“ bestimmte täglich die Wahl der Kleidung. Sie wurde mit Hilfe entsprechender Auszier und Accessoires oder durch neue Einzelstücke schrittweise „modernisiert“. So setzte sich die Bekleidung einer Person oft aus geerbten Teilen verschiedensten Alters und wenigen neuen Stücken zusammen. Und doch lassen sich bei der bäuerlichen Kleidung die Moden der jeweiligen Zeit deutlich erkennen.
Die Tracht ist langsam gewachsen. Sie hat die die Anregungen und Bestandteile der vergangenen Moden aufgenommen, integriert und so konserviert. Hier sind prägende Aspekte verschiedener Zeiten in immer wechselnden Kombinationen und regionalen Ausprägungen verschmolzen. Zum Beispiel war die Kleidermode des Barock im 18. Jahrhundert stilprägend für die bäuerliche Standeskleidung. Anfangs bestimmten Dreispitz, Kniehosen, die vorwiegend rote Weste und lange offene Mäntel mit Knöpfen und Aufschlagtaschen das Erscheinungsbild der Männer. Steife Schnürmieder mit Vorstecker und Goller in verschiedensten Macharten, andersfarbige weite Röcke und zum Teil schillernde Schürzen prägten die Frauentrachten im ganzen süddeutschen Raum. In manchen Gebieten, z.B. in der Trachtenlandschaft zwischen Reutlingen und Tübingen, haben sich diese Grundformen der Tracht bis ins 20 Jahrhundert erhalten. In vielen Gegenden kam es allerdings im 2. Drittel des 19. Jahrhunderts zu starken Veränderungen, vor allem bei der Kleidung der Frauen und Mädchen. In Schnittform und Materialwahl hatte die Mode des Biedermeier einen grossen Einfluss. Schwere Tuche wurden durch leichtere, billigere Stoffe verdrängt. So wurden leichtere Mieder ohne Vorstecker und Schnürung aus klein gemusterten Stoffen, beliebt, deren weiter Ausschnitt, mit buntem Band verziert wurde. Bei den Männern wird die Kniehose durch lange Hosen ersetzt.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Kleidung nüchterner und dunkler, Mieder waren weitestgehend hochgeschlossen, doch in den fein bestickten schwarzen Samtleible hat sich das Biedermeier erhalten. Um die Jahrhundertwende bediente man sich noch einmal bei der städtischen Mode und so finden sich heute in den Nachlässen oft die für diese Zeit typischen Frauenjacken als Zubehör zur Tracht. Zu den ältesten Stücken im Museum gehört, z.B. ein hellblaues Seidenmieder aus Eutingen. Gerade von den Eutinger Trachten sind in den Stilen des 19. Jahrhunderts viele Stücke gut erhalten und ermöglichen es uns, anhand der Tracht dieses Ortes, die Veränderungen von Form und Material zu zeigen. An Festtagen wurden zur Tracht kostbare Hauben – in Eutingen z.B. mit Brokatstickerei – getragen. Im Alltag hingegen, nutzte die Bäuerin je nachdem, was sie tat und wo sie hin wollte, verschiedene Kopftücher. Lediglich bei Hochzeiten, Beerdigungen oder an Feiertagen wurde die Tracht aufwendiger und kostbarer. Auch die Hauben wurden nur zu diesen Anlässen in der Kirche oder bei Familienfesten getragen.
Neuere Entwicklungen am und im Museum
Seit 2011 ist das Museum Informationszentrum des Biosphärengebietes Schwäbische Alb.
Dadurch wurde es möglich, zwei Projekte umzusetzen. Zum einen, eine interaktive Karte, auf der sich mittels eines Touchscreens Informationen über Verbreitung und Bedeutung der Kleidungsstücke abrufen lassen. Zum anderen lässt eine Audiostation die Trachten buchstäblich sprechen. Mode, Dorftratsch und Hochzeit sind die drei Alltagssituationen, die da auf schwäbisch zu hören sind. Beim Anhören dieser Dialoge, zwischen den verschiedensten „Albtrachten“, bekommt man eine Vorstellung davon, wie es früher gewesen sein könnte. Ergänzt wird das Bild von einer einzigartigen Spende, die die gesamte Kleidung aus dem Besitz von Katharina Bückle (1916 – 2014) aus Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) umfasst. Darunter ihr seidenes Hochzeitskleid in Schwarz, damals die übliche Hochzeitsfarbe. Die Tracht ist ein Teil der Alltagsgeschichte unserer Heimat. Inzwischen gibt es kaum noch Zeitzeugen und so kann beim Recherchieren nur noch auf schriftliche Quellen oder Bilder zurückgegriffen werden, deren Informationen aber nur teilweise der Realität entsprechen. Archivierung und Recherche sind ein grosser Teil der Museumsarbeit.